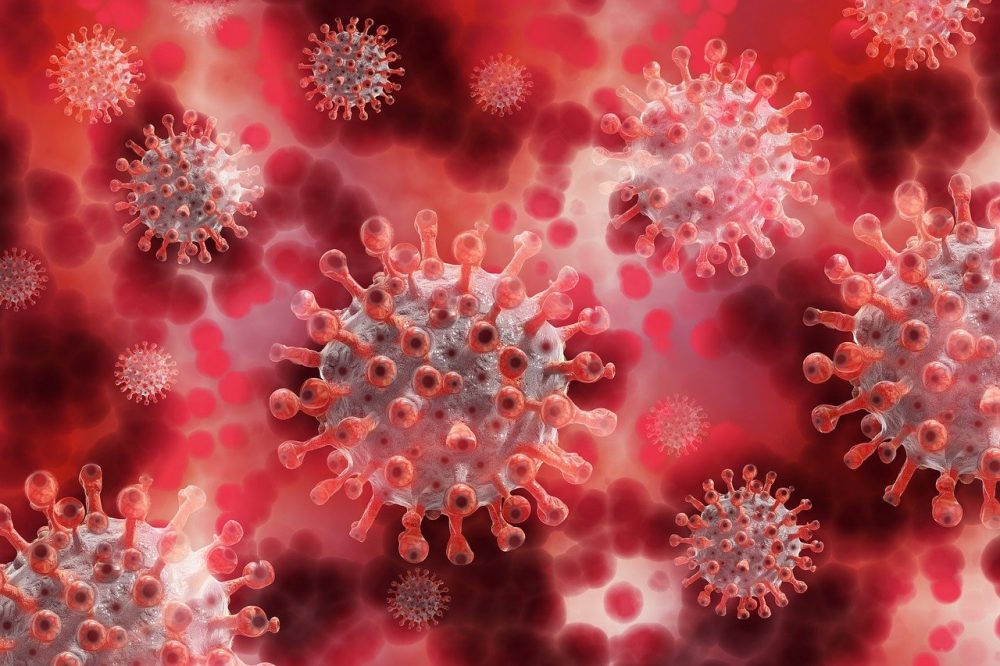Sonntagsbotschaft für 7. Februar 2021 (5. Sonntag im Jahreskreis / Lesejahr B)
Und / oder zum (Mit-)Lesen:
Was macht eigentlich „Corona“ mit Ihnen?
Ich merke jetzt erst, wie sehr mir das fehlt, niemanden umarmen zu können. Sich unbekümmert mit jemandem treffen? Geht nicht. Kein Konzert. Nicht mal essen gehen. Das macht mich traurig.
Ich könnte krank werden oder gar daran sterben. Das ängstigt mich.
Bin ich schon infiziert, also für andere ansteckend? Das verunsichert mich.
Ich mache mir Sorgen wegen der Kinder. Derartige Einschränkungen ihrer Erfahrungen und ihrer Kontakte! Hoffentlich wird das ihre Entwicklung nicht stören!
Ich sehe die dementen Alten, die die Pandemie zusätzlich verwirrt, und bin entsetzt über die Übersterblichkeit – in manchen Altenheimen offensichtlich über 30%!
Und die Beschäftigten im Supermarkt und anderswo, auf denen viele Leute jetzt einfach ihren Frust abladen.
Den Stress finde ich entsetzlich, unter dem das Pflegepersonal in Krankenhäusern steht.
Und wer wird die so wichtigen Dienstleistungen in Kultur, Gastronomie, Veranstaltungswesen und anderen Branchen erbringen, wenn viele davon pleite gegangen sind?
Alle stecken sie in ihren Löchern und trauen sich nicht hervor. Ich auch nicht. Das ärgert mich.
Und dann gibt es Menschen, die trifft es doppelt und dreifach: Zusätzlich zur gefährdeten Gesundheit auch noch Homeschooling und Homeoffice zugleich, womöglich noch alleinerziehend und mit 2 oder 3 Kindern! In anderen Familien Stress und Ausrasten bis zur körperlichen Gewalt. Oder wirtschaftliche Pleite und Zusammenbruch der Familie …
Mich erinnert das an Ijob,
den Mann aus der Bibel, über dem alles zugleich zusammenstürzt,
was man sich nur vorstellen kann: Ihm werden die Rinderherde und die Kamele gestohlen und dazu die Knechte erschlagen, seine Schafherde kommt im Gewitter um – samt den Hirten. Ein Sturm zerstört das Haus, in dem seine Söhne und Töchter gemeinsam ein Fest feiern, und begräbt sie alle unter sich. Dazu breiten sich bösartige Geschwüre über seinen ganzen Körper aus – von der Fußsohle bis zum Scheitel. Und da gibt es Leute, die sagen auch noch „Jammer nicht! Damit änderst du nichts. Und anderen geht’s noch schlimmer.“ —
Und Ijob – wie reagiert er in diesem Kampf, in diesem „Kriegsdienst“, wie er es nennt? In der ersten Bibellesung dieses Sonntags begegnen wir ihm (Ijob 7, 1-4.6-7):
Lesung aus dem Buch Ijob:
Ijob ergriff das Wort und sprach: Ist nicht Kriegsdienst des Menschen Leben auf der Erde? Sind nicht seine Tage die eines Tagelöhners? Wie ein Knecht ist er, der nach Schatten lechzt, wie ein Tagelöhner, der auf den Lohn wartet. So wurden Monde voll Enttäuschung mein Erbe und Nächte voller Mühsal teilte man mir zu. Lege ich mich nieder, sage ich: Wann darf ich aufstehen? Wird es Abend, bin ich gesättigt mit Unrast, bis es dämmert. Schneller als das Weberschiffchen eilen meine Tage, der Faden geht aus, sie schwinden dahin.
Er spricht es also erst mal aus, benennt sein Leid, sagt, wie es ihm damit geht, „jammert“, wie manche sagen. Die Bibel präsentiert ihn uns sozusagen als Modell. Und dann wird deutlich, vor wessen Ohren er das ausspricht, in wessen Gegenwart er sich weiß:
Denk daran, dass mein Leben nur ein Hauch ist. Nie mehr schaut mein Auge Glück.
Unwillkürlich erinnert mich das auch an die Lesung der Tagzeitenliturgie am Sonntagmorgen vor zwei Wochen, als ich traurig war über das Leid, dass zur Zeit
alle Welt – wie in Gräbern – „in ihren Löchern“ bleibt.
Geradezu überfallen hatte mich dazu das Prophetenwort aus dem Buch Ezechiel (37,12b-14):
So spricht Gott, der Herr: Ich öffne eure Gräber und hole euch, mein Volk, aus euren Gräbern herauf. Ich bringe euch zurück in das Land Israel. Wenn ich eure Gräber öffne
und euch, mein Volk, aus euren Gräbern heraufhole, dann werdet ihr erkennen, dass ich der Herr bin. Ich hauche euch meinen Geist ein, dann werdet ihr lebendig, und ich bringe euch wieder in euer Land. Dann werdet ihr erkennen, dass ich der Herr bin. Ich habe gesprochen, und ich führe es aus – Spruch des Herrn!
Bei Ezechiel geht es um die nach Babylonien Verschleppten, die sich in der Unterdrückung durch König Nebukadnezzar in ihren „Löchern“ wie tot und begraben vorkamen. Eine Situation, die durch Giuseppe Verdi neu bekannt wurde durch seine Oper „Nabucco“ mit dem Gefangenenchor „Teure Heimat, wann seh ich dich wieder“.
In dämonischer Unfreiheit wie begraben. Und Gott lässt ihnen ausrichten: Daran werdet ihr mich erkennen und wie ich wirklich bin, wenn ich euch daraus befreie und euch von neuem in den euch entsprechenden Lebensraum führe.
Das bestärkt in einer hoffnungsvollen und zukunftsschwangeren Einstellung, die den Ijob auf eine Neuauflage seines Lebensglücks vorbereitet und die nach Babylonien verschleppten Juden auf neues Leben in ihrem Land.
Kann dieser Gott sich auch uns Menschen in dieser Corona-Pandemie so zeigen und zu erkennen geben?
Vielleicht ist mein Blick auf unsere Situation ja bereits durch solche biblische Sichtweise infiziert. Denn auch wenn ich mir das Recht zur Klage über das Leid – meinetwegen zum „Jammern“ – einfach nicht nehmen lasse und deswegen mit möglichst gut analysierendem Blick genau hinschaue und benenne, was ich sehe, – trotzdem lasse ich mich davon nicht beherrschen, sondern pflege auch die andere Blickrichtung. Da sehe ich viel Aufrichtendes, was mich neugierig und hoffnungsvoll macht:
Das Klima wird durch weniger Flugbenzin-Abgase belastet.
Durch vermehrtes Homeoffice bedingt, sinkt insgesamt die Verkehrsmenge und Verkehrsdichte. Viele Menschen ersparen sich die Pendelei samt Stress, Staus und Zeitvergeudung.
Ich suche, teste und nutze vermehrt andere Wege der Kommunikation und des Kontaktes. Zum ersten Mal habe ich vor kurzem mit einem Verwandten in Kalifornien ein Video-Meeting von einer ganzen Stunde Dauer gehabt!
Irgendwie habe ich mehr Zeit als vor Corona. Wegzeiten entfallen ja für Treffen, die jetzt online stattfinden.
Und mir scheint, der Blick der Menschen füreinander hat zugenommen; nicht zuletzt auf der Straße, wo man bei Begegnungen zu Fuß Abstände per Blickkontakt austariert und sich jetzt auch unter Fremden öfter gegenseitig grüßt.
Menschen entfalten kreativ für alles Mögliche neue Ideen, die auch ohne Corona sinnvoll sind: Familien nutzen aufgezwungene gemeinsame Zeit fantasievoll für überraschend entstehende neue Freude am Miteinander. Zur existenzbedrohenden Untätigkeit Gezwungene entwickeln neue Startup-Ideen, andere finden neue Freude an ehrenamtlichen Tätigkeiten, die jetzt besonders gefragt sind.
Ganz allgemein hat anscheinend das Bewusstsein zugenommen: Wir Menschen sind Teil der Natur und angewiesen auf vieles, was uns da vorgegeben ist. Wir sind auch auf solidarische Rücksichtnahme angewiesen und, uns aufeinander abzustimmen.
Was ist das nun also – „Corona“?
Ein Dämon? Eine Krankheit? Ein Naturphänomen – wie eine Überschwemmung oder ein Gewitter von katastrophalen Ausmaßen?
Ein Impuls, der angesichts unbrauchbar gewordener Gewohnheiten
kreativ werden lässt für neue Verhaltensweisen?
Eine Gelegenheit, globale Entwicklungen zu korrigieren, die auch unter „normalen“ Umständen schädlich bis todbringend sind, die sich unter Corona-Bedingungen aber als geradezu katastrophal erweisen?
Zwar haben mich von jungen Jahren an technische Fortschritte schon immer fasziniert; auch wenn ich jetzt von der Konkurrenz lese zwischen dem japanischen Shinkansen und der chinesischen Magnetschwebebahn, sehe ich zuerst die Chance, den Irrsinn von Kurzstreckenflügen zu besiegen. Aber reicht denn die Schnelligkeit immer noch nicht? Es ist ja dieselbe Schnelligkeit, mit der wir das Virus ausbreiten! Und ist die Schnelligkeit auf deutschen Autobahnen wichtiger als die Vermeidung von Unfalltoten?
Haben wir nicht längst eine Linie überschritten,
ab der damit Schluss sein muss und die Vermeidung von Verkehr, von Naturversiegelung und von Lebensraumzerstörung angesagt ist?
Grenzenlosigkeit gibt es nur im Universum. Wir aber leben auf der Erde! Wir müssen uns neu mit unseren Grenzen und unserer Begrenztheit beschäftigen!
Schlimm genug, wenn es für solche verantwortungsvollen Umsteuerungen eine solche Krise wie Corona braucht! Aber das wenigstens jetzt wahrzunehmen, ist doch eine große Chance, die wir unbedingt nutzen müssen!
Dass eine Welt, die – wie von einem Dämon besessen – meint, mit ihrer Wirtschaft grenzenlos wachsen zu müssen, sich dadurch selbst zerstört, darauf hat vor einem halben Jahrhundert schon der Club of Rome hingewiesen. Dass eine nur noch auf Profitmaximierung zielende, alles beherrschende, aber innovations-scheue Finanzindustrie die Welt an die Wand fährt, weil die Investoren den Blick für den Menschen und für die Natur verloren haben, das löst in vielen Ländern soziale Bewegungen aus, deren Potential durch die alten Kräfte wie besessen und gewalttätig in Schach gehalten werden. Die hier wirkenden Kräfte nur auf Gier und Korruption zurückzuführen, übersieht, dass daraus längst systemische „Dämonen“ entstanden sind, durch deren Übermacht verursacht, Menschen an „Krankheiten“ aller möglichen Arten zu leiden haben.
Dagegen tritt Jesus auf
mit seinem neuen Geist von Gottes Menschenfreundlichkeit.
Die Botschaft des Abschnitts aus dem Markus-Evangelium, der für diesen Sonntag auf dem Programm steht (1,29-39), kann uns aufrichten, Mut machen, und zum Mitmachen anstecken:
In jener Zeit ging Jesus zusammen mit Jakobus und Johannes in das Haus des Simon und Andreas. Die Schwiegermutter des Simon lag mit Fieber im Bett. Sie sprachen sogleich mit Jesus über sie und er ging zu ihr, fasste sie an der Hand und richtete sie auf. Da wich das Fieber von ihr und sie diente ihnen.
Am Abend, als die Sonne untergegangen war, brachte man alle Kranken und Besessenen zu Jesus. Die ganze Stadt war vor der Haustür versammelt und er heilte viele, die an allen möglichen Krankheiten litten, und trieb viele Dämonen aus. …
In aller Frühe, als es noch dunkel war, stand er auf und ging an einen einsamen Ort, um zu beten. Simon und seine Begleiter eilten ihm nach, und als sie ihn fanden, sagten sie zu ihm: Alle suchen dich. Er antwortete: Lasst uns anderswohin gehen, in die benachbarten Dörfer, damit ich auch dort verkünde; denn dazu bin ich gekommen. Und er zog durch ganz Galiläa, verkündete in ihren Synagogen und trieb die Dämonen aus.
Lied aus Gottesdienst (1994):
Du, Gott, Freundin der Menschen, Freund dieser Erde, wann werden wir sichtbar, Gott, als Töchter und Söhne in deinem Reich, Gott, …
(Text und Melodie aus: Heidi Rosenstock, Hanne Köhler: Du Gott, Freundin der Menschen. Neue Texte und Lieder für Andacht und Gottesdienst. 1991)
Weiterführende Reflektion:
Franz-Josef Overbeck, Bischof von Essen, Fragilität und Hoffnung in der Pandemie. Ein sozialethischer Zwischenruf zu Corona; in: Anzeiger für die Seelsorge, Heft 2/2021, S. 11-14
… Eine Zeit, die uns so deutlich die ohnmächtige Verwundbarkeit des Menschen als individuelles und soziales Wesen vor Augen führt, erfordert gegenseitigen Halt in der Gesellschaft. Der Mensch ist gleichsam „auf Mit-Sein angelegt“ (Mater et Magistra) und in der Pandemie tritt seine Sozial- und Sozialstaatsbedürftigkeit deutlich hervor. Ein funktionierender Sozialstaat ist mithin die Grundvoraussetzung für die Kompetenz unserer Gesellschaft zur Krisenbewältigung. Neben einer Rückbesinnung auf den Wert wissenschaftlicher Erkenntnisse und einer faktenbasierten Bewertung von Vorgängen bleibt für uns Christen das Vertrauen auf den liebenden und ewigen Gott im Zentrum, der sich in diese Fragilität menschlichen Lebens hineinbegeben hat und in ihr selbst Mensch geworden ist. Für uns ist die Überzeugung zentral, dass wir uns von Gottes Liebe zu uns Menschen und von der darin begründeten Hoffnung getragen wissen, dass trotz und im Verlaufe mancher Schwierigkeit eben dieser Gott ein „Gott mit uns“ ist. In seiner Nachfolge sind wir aufgerufen zu Solidarität und Geschwisterlichkeit. …